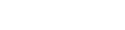Lange Nacht der Wissenschaften Leipzig
23. Juni 2023 | 18:00 - 23:00 Uhr
Leipzig weiß Bescheid!
Mit dabei ist auch wieder die Forschungsstelle Leipzig des Helmholtz-Zentrums Dresden-Rossendorf.
Veranstaltungsort: Wissenschaftspark Leipzig, Permoserstraße 15, 04318 Leipzig
P R O G R A M M
EXPONATE
"Chemielabor der Zukunft – Robotik in Chemie "
PD Dr. Agniezska Kuc, Dr. Augusto Faria Oliveira, I. Eren, Prof. Dr. Thomas Heine, Florian Arnold, Beatriz Costa Guedes
18:00 - 23:00 Uhr | Gebäude 9.3, Raum 120
Komm und sieh dir einen ersten Prototyp des Chemielabors der Zukunft an: einen Chemieroboter!
Er ist ein Traum des Chemikers - programmiere einfach, was er für dich erledigen soll, und beobachte, wie er es umsetzt. Wie ein Robo-Barkeeper! Das Beste daran: Du kannst alles selbst anfassen, denn alles ist aus Lego gebaut.
Es ist wirklich eine Revolution in der Wissenschaft: Roboter und künstliche Intelligenz werden großartige Helfer im Labor, um mühsame oder sogar gefährliche Arbeit zu verrichten.
Molekulare Bausteine: Wie sieht die Welt aus der Nähe aus?
PD Dr. Agniezska Kuc, Dr. Augusto Faria Oliveira, Elvira Gouatieu Dongmo, Florian Arnold, Beatriz Costa Guedes
18:00 - 23:00 Uhr | Gebäude 9.3, Raum 120
Wer weiß, wie Moleküle aussehen? Hier wird die Welt im Nanomaßstab entdeckt! Wir modellieren mit molekularen Bausteinen interessante Moleküle und bauen zusammen große Materialmodelle – sowohl in echt als auch am Computer. Können wir Ihre Augen täuschen?
Moleküle sind die Bausteine unserer Welt: überall, aber kaum zu sehen. Glücklicherweise ermöglicht es uns die Computertechnologie, Moleküle und Materialien genau zu simulieren und so ihre Struktur und Eigenschaften vorherzusagen.
Auf der Spurensuche mit der „Wilsonschen Nebelkammer“
Claudia Schößler, Dagmar Lösel
18:00 - 23:00 Uhr | Gebäude 9.3, Raum 210
Ionisierende Strahlung ist geschmack- und geruchlos. Man sieht und spürt sie nicht. Wie kann man sie „sehen und verstehen“?
Mit der „Nebelkammer“ können elektrisch geladenen Teilchen, die bei der radioaktiven Umwandlung entstehen, nachgewiesen werden.
Beobachten Sie den Zerfall von Thorium, einer Quelle der natürlichen Radioaktivität und verfolgen Sie die Nebelspur!
Nanopartikel-Cocktail gefällig?
Dr. Stefan Schymura
18:00 - 23:00 Uhr | Gebäude 9.3, Foyer
Was versteht man unter technologisch interessanten Nanopartikeln? Wo findet man sie? Wie verhalten sie sich? In der Nano-Umweltforschung am HZDR werden Größe, Oberflächenladung und Aggregationsverhalten der Nanopartikel untersucht, aber wie ist das möglich?
Die Sichtbarmachung der extrem kleinen Partikel (1 nm = 1 Milliardstel Meter) durch die Streuung von Licht ist spannend und wird anhand des Louche-Effekts (Bildung kleiner Öltröpfchen in Alkohol) gezeigt.
FÜHRUNGEN
Ein Teilchenbeschleuniger für Medizin und Geologie – Wie mit dem Zyklotron radioaktive Sonden für Forschung und Anwendung bereitgestellt werden
Dr. F.-Alexander Ludwig
Gebäude 9.3, Laborbereich
Führungszeiten: 18:30 - 19:10 Uhr / 19:30 - 20:10 Uhr / 20:30 - 21:10 Uhr / 21:30 - 22:10 Uhr / 22:30 - 23:10 Uhr
Wie kann man Radionuklide sicher herstellen und diese für die Forschung nutzbar machen? Welche finden mit Hilfe von Radiochemie und Nuklearmedizin den Weg in bildgebende Diagnoseverfahren und helfen dabei, Tumore frühzeitig sicher zu erkennen? Warum spielen andere eine Rolle bei der Erforschung von Transportprozessen in Gesteinsschichten und sind damit von Bedeutung bei der Auswahl von Endlagern für radioaktiven Abfall?
Nicht für Personen unter 18 Jahren und nicht für Schwangere und Stillende!
Was läuft da ab? Fließprozesse im Gestein mit Radiotracern sichtbar gemacht
Dr. Johannes Kulenkampff, Jann Schöngart
Gebäude 9.3 und 4.0, Raum 263
Führungszeiten: 18:30 - 19:10 Uhr / 19:30 - 20:10 Uhr / 20:30 - 21:10 Uhr / 21:30 - 22:10 Uhr / 22:30 - 23:10 Uhr
Probleme im Untergrund werden oft übersehen, weil die ablaufenden Prozesse nicht sichtbar sind und materialtypische Eigenschaften falsch bewertet werden. Bildgebende Methoden aus der Nuklearmedizin mit hoher Auflösung und Empfindlichkeit dienen uns, Licht ins Dunkel zu bringen.
Kommen Sie mit uns über “Wasseradern”, nachhaltige Grundwassernutzung und sichere Endlagerung radioaktiver Substanzen ins Gespräch!
Nicht für Personen unter 18 Jahren und nicht für Schwangere und Stillende!
Radioaktivität in der Hand – Wie werden radioaktive Substanzen synthetisiert, um sie als Sonden zur Früherkennung von Krebs zu nutzen?
Dr. Barbara Wenzel, Dr. Rares-Petru Moldovan
Gebäude 9.3 und 4.0, Raum 257
Führungszeiten: 18:30 - 19:10 Uhr / 19:30 - 20:10 Uhr / 20:30 - 21:10 Uhr / 21:30 - 22:10 Uhr / 22:30 - 23:10 Uhr
Bleiburgen, heiße Zellen, Syntheseautomaten, Dosimeter und vieles mehr befinden sich im Radiochemielabor. Wir zeigen ihnen, worauf es ankommt, um mit kurzlebigen radioaktiven Substanzen forschen zu können. Wie werden kleine radioaktive Moleküle hergestellt, die dann als sogenannte radioaktive Sonden helfen, den Krebs zu entdecken und zu behandeln? Wie schützen wir uns vor der radioaktiven Strahlung während der Syntheseversuche?
Nicht für Personen unter 18 Jahren sowie Schwangere und Stillende!
VORTRÄGE
Nuklearmedizin – Nu, klar! Radioaktive Sonden, um Krebs frühzeitig erkennen und bekämpfen zu können
Dr. Daniel Gündel
19:00 - 19:30 Uhr | Gebäude 9.3, Raum 216
Was ist eigentlich Nuklearmedizin? Hat das was mit Radiologie oder Strahlentherapie zu tun? Entstehen da Bilder, wie beim Röntgen? Und was sind eigentlich radioaktive Sonden? Was machen die in meinem Körper? Ist das gefährlich? Wenn Sie sich diese Fragen stellen, finden Sie bei uns Antworten. Denn wir forschen daran, mit kleinen radioaktiven Molekülen dem Krebs auf die Spur zu kommen und zu therapieren.
Bewegung im Untergrund
PD Dr. Cornelius Fischer
20:00 - 20:30 Uhr | 21:00 - 21:30 | Gebäude 9.3, Raum 216
Die Entsorgung radioaktiver Abfälle ist ein aktuelles Problem – in Deutschland und international. Damit verknüpft ist die Prognose der Schadstoffausbreitung für enorm lange Zeiträume. Wir beantworten Fragen, die für die Endlagerung wichtig sind: Wie bewegen sich Schadstoffe durch Gesteine? Wie können Radionuklide festgehalten werden, damit sie nicht in den Wasserkreislauf gelangen?