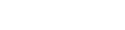Institut für Strahlenphysik
Wissenschaftliches Profil und Forschungsprogramm
Das Institut für Strahlenphysik erforscht Zustände von Materie unter extremen Bedingungen und in sehr kleinen Dimensionen. Um grundsätzliche physikalische Phänomene zu untersuchen werden modernste Strahlungsquellen eingesetzt. Daher ist der Aufbau neuartiger Beschleuniger und die Weiterentwicklung und Verbesserung vorhandener Anlagen ein wesentliches Ziel des Institutes. Hochleistungslaser ermöglichen die Untersuchung der Wechselwirkungen von Licht und Materie. Für den Nachweis der Effekte auf kleinsten Skalen werden hochpräzise und sehr schnelle Detektoren entwickelt und eingesetzt. Die Verwendung der neuesten Hochleistungs-GPU-Computing-Technologie sorgt für eine Echtzeit-Handhabung großer Daten und setzt weltweite Standards für Open-Source-Simulationswerkzeuge für komplexe Systeme.
Neben der Grundlagenforschung ist die Anwendung der Technologien ein zentrales Thema. In der modernen Strahlentherapie werden Entwicklungen aus unserem Haus eingesetzt. Die Forschung ist eingebettet in die Forschungsthemen “Materie” und „Gesundheit“ der Helmholtz-Gemeinschaft.
Einrichtungen und Kooperationen
Das Institut für Strahlenphysik betreibt das ELBE-Zentrum für Hochleistungs-Strahlenquellen und kombiniert dabei erfolgreich Forschung mit Nutzerbetrieb. ELBE besteht aus einem supraleitenden Elektronenbeschleuniger und zwei Hochleistungslaseranlagen, den Ultrakurzpulslaser „Draco“ und ein in der Entwicklung befindliches vollständig diodengepumptes energieeffizientes Petawattsystem „Penelope“.
Das Spektrum der ELBE-Sekundärstrahlungsquellen im Nutzerbetrieb umfasst IR-FEL-Strahlung (FEL), MeV-Bremsstrahlung, Positronen, Neutronen und zwei superradiante THz-Quellen.
Weiterhin koordiniert das Institut für Strahlenphysik den Aufbau der Helmholtz International Beamline for Extreme Fields (HIBEF) am European XFEL am DESY in Hamburg im Rahmen eines internationalen Nutzerkonsortiums.
Das Institut für Strahlenphysik arbeitet mit dem Institut für Radioonkologie - OncoRay – Nationales Zentrum für Srahlenforschung in der Onkologie zusammen. Ziel ist dabei die Entwicklung von Zukunftskonzepten für die Strahlentherapie.
Im Zukunftsprojekt Dresden Advanced Light Infrastructure (DALI) wird eine zukünftige beschleunigergetriebene langwellige Strahlungsquelle im THz-Spektralbereich und eine hochintenisve Positronenquelle entwickelt. DALI SMWK Sonderfinanzierung
Nachwuchsförderung
Eine weitere Aufgabe des Instituts ist die Förderung der Fortbildung des wissenschaftlichen und technischen Nachwuchses. Junge Wissenschaftler (Masterstudenten und Doktoranden) aus in- und ausländischen Hochschulen haben die Möglichkeit, interdisziplinäre Themen der angewandten Grundlagenforschung in modernen Laboratorien im Rahmen von Master- und Promotionsarbeiten unter Anleitung erfahrener Wissenschaftler zu bearbeiten. Durch Institutsangehörige werden darüber hinaus das umfangreiche Fachwissen und ein großer Erfahrungsschatz in die Lehre an der TU Dresden eingebracht.
Am Institut forschen derzeit fünf Nachwuchsgruppen. Seit 2015 leiten Dr. Karl Zeil und Dr. Arie Irman die Nachwuchsgruppen „Laserionenbeschleunigung“ und Laser-Laser-electron acceleration and advanced radiation sources. Im Jahr 2016 wurde die Helmholtz-Nachwuchsgruppe von Dr. Dominik Kraus zum Thema „Erforschung von warmer dichter Materie an HIBEF“ eingeworben. 2017 startete Dr. Josefine Metzkes-Ng mit einer Nachwuchsgruppe zum Thema "Anwendungsorientierte Laserteilchenbeschleunigung" und 2018 ergänzte Dr. Katerina Falk das Portfolio mit der Helmholtz-Nachwuchsgruppe "Entwicklung neuartiger Laser-Wakefield-Sonden zur Untersuchung der Struktur- und Transporteigenschaften astrophysikalisch relevanter dichter Plasmen".
Helmholtz-Verbünde
Das Institut für Strahlenphysik ist am Helmholtz Energy Materials Characterization Platform (HEMCP) beteiligt. Mit sechs weiteren Helmholtz-Zentren wird am Aufbau der gemeinsamen Labor-Plattform HEMCP für die Analyse neuartiger Energiematerialien gearbeitet. Im Rahmen dieser Plattform wird der Aufbau von AIDA II gefördert.
Seit 2017 wird das Projekt „Plasma Accelerators - Probing the femto-scale dynamics of relativistic plasmas” (Plasma-Beschleuniger – Erforschen der Femto-Skalendynamik relativistischer Plasmen) von der Helmholtz-Gemeinschaft gefördert.
Ebenfalls im Jahr 2017 wurde das Weizmann-Helmholtz Laboratory for Laser Matter Interaction (WHELMI) im israelischen Rechovot gegründet.