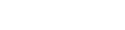Wie nutzt man Energie und Ressourcen effizient, sicher und nachhaltig?
Energieversorgung, Rohstoffgewinnung und -recycling sowie die Entsorgung von Rückständen sind Herausforderungen, denen sich heutige und künftige Generationen stellen müssen. Die Helmholtz-Energieforscherinnen und -forscher suchen deshalb nach Lösungen, um vorhersehbaren globalen Engpässen und den Anforderungen der modernen Gesellschaft gerecht zu werden.
Am HZDR gliedert sich der Forschungsbreich Energie in drei Programme:
- Energieeffizienz, Materialien und Ressourcen
- Speichertechnologien
- Nukleare Entsorgung, Sicherheit und Strahlenforschung
Energieeffizienz, Materialien und Ressourcen
Eine der größten Herausforderungen unserer Zeit ist die Knappheit von Rohstoffen und die daraus resultierende, unabdingbar gewordene Einsparung von Energie und Ressourcen. Wie kann man industrielle Prozesse effizienter machen? Wie können wir den Bedarf an Rohstoffen für die Wirtschaft sichern? Wie nutzt man Ressourcen und Energie effizient, sicher und nachhaltig? Das sind die drei großen Fragen, mit denen sich HZDR-Wissenschaftlerinnen und -Wissenschaftler im Forschungsprogramm "Energieeffizienz, Materialien und Ressourcen" befassen.
Gerade vor dem Hintergrund der Energiewende in Deutschland gilt es, die Wirtschaftlichkeit, Nachhaltigkeit und Wettbewerbsposition der Industrie zu stärken. Industrielle Prozesse müssen effektiver werden und sich an zeitlich fluktuierende Ströme von Energie und Rohstoffen anpassen. Mit diesem Themenkomplex beschäftigt sich das Institut für Fluiddynamik am HZDR nach.
Um neue und umweltschonende Technologien zur Erkundung, Gewinnung und Nutzung von Rohstoffen im Sinne einer Kreislaufwirtschaft geht es dagegen am Helmholtz-Institut Freiberg für Ressourcentechnologie. Dieses HZDR-Institut arbeitet sehr eng mit der TU Bergakademie Freiberg zusammen.
Aktuelle Forschungsthemen:
Ziele
- Transportprozesse von der molekularen Skala an Grenzflächen bis hin zur gesamten Anlage unter industrierelevanten Prozessbedingungen besser verstehen.
- Physikbasierte, validierte Modelle für Strömung, Wärme- und Stoffübergang gewinnen sowie Berechnungsmethoden und Tools zur Unterstützung der Auslegung von Prozessen entwickeln.
- Methoden zur Instrumentierung, Intensivierung und Kontrolle von industriellen Prozessen entwickeln und implementieren
- Neue Technologien entwickeln, um mineralische und metallhaltige Rohstoffe aus komplex zusammengesetzten, heimischen und internationalen Lagerstätten nutzbar zu machen.
- Einen Beitrag zum globalen Umweltschutz leisten, indem Rohstoffe ressourcen- und energieeffizient gewonnen und verwendet werden.
- Nachhaltige Technologien für deutsche Unternehmen bereitstellen als Basis für die wirtschaftliche Vernetzung mit ressourcenreichen Ländern.
- Eine neue Generation hochqualifizierter Wissenschaftler und Techniker für die deutsche Industrie und den Hochschulsektor ausbilden
Speichertechnologien
Die Energiewende hat ein Problem: Die von Photovoltaik und Windturbinen eingespeiste Leistung hängt von den Umgebungsbedingungen und nicht vom aktuellen Bedarf ab. Deswegen sind preiswerte Speicher unerlässlich, um Angebot und Nachfrage auszugleichen. Die HZDR-Wissenschaftlerinnen und -Wissenschaftler erforschen und konstruieren im Programm "Elektrochemische Speicherung" neuartige Flüssigmetall-Batterien. Diese könnten mit verhältnismäßig geringen Kosten große Mengen Energie speichern. Im Mittelpunkt der Forschung stehen sowohl das Verständnis von stromgetriebenen Instabilitäten in den Batterien als auch die Verhinderung solcher Effekte. Dafür experimentieren die Wissenschaftler an Flüssigmetallen und Salzschmelzen und führen rechenintensive Simulationen durch.
Aktuelles Forschungsthema:
Ziele
- Strömungen in heißen Metall- und Salzschmelzen messen, simulieren und beeinflussen
- stromgetriebene Instabilitäten verstehen und beherrschen
- zur Konstruktion großtechnischer Flüssigmetallbatterien beitragen
Nukleare Entsorgung und Sicherheit
Auch wenn in Deutschland der stufenweise Atomausstieg bis 2022 beschlossene Sache ist, befassen sich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler weltweit weiter mit der Frage der Sicherheit von Kernkraftwerken und Endlagern. Um eventuelle Störfälle in Reaktoren zu verhindern bzw. zu beherrschen und um die mögliche Ausbreitung von Radionukliden in der Umwelt und an potentiellen Endlager-Standorten genau vorhersagen zu können, müssen wir noch viel mehr über diese hochkomplexen Prozesse wissen.
Aktuelle Forschungsthemen
Ziele
-
besseres Prozessverständnis für die Langzeit-Sicherheitsanalyse nuklearer Endlager im tiefen geologischen Untergrund
-
Entwicklung von neuen Gerätesystemen, um ein besseres Prozessverständnis zur Verteilung der Radionuklide in Bio- und Geosystemen auf molekularer und zellulärer Ebene zu erreichen
-
Erfassen von Daten für die Langzeit-Sicherheitsanalyse nuklearer Endlager
- Entwicklung und Anwendung von Methoden zur Sicherheitsanalyse von derzeit betriebenen Kernreaktoren sowie neuen in Planung befindlichen Reaktortypen in den Nachbarländern
-
Untersuchung von Alterungsphänomenen durch Neutronenbestrahlung in Baumaterialien von Kernreaktoren